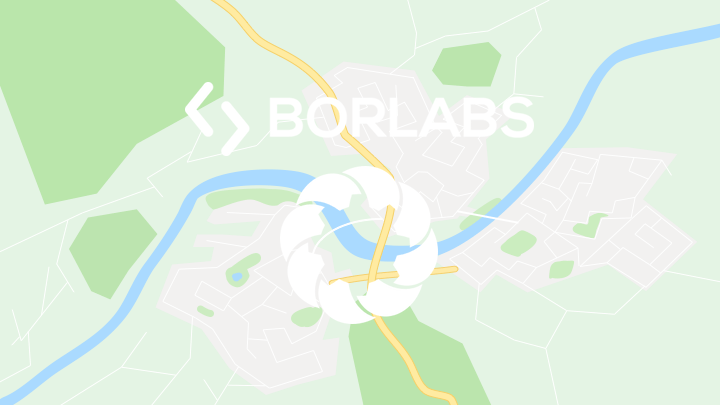Für Sie gelesen
Aktuelles aus Forschung und Entwicklung
Wir lesen regelmäßig für Sie und halten die Ohren auf: Hier fassen wir für Sie Publikationen, Artikel und Meinungen aus der medizinischen Medienwelt zusammen. Alles, was wichtig ist, neugierig oder nachdenklich macht – rund um die Themen Gesundheit, Medizinforschung, Labordiagnostik und Therapeutik.
+
–
Wie wirkt vegane oder ketogene Diät auf die Immunität?
Wie die Ernährung die menschliche Immunität beeinflusst, ist noch weitgehend unbekannt. Die Fachzeitschrift Nature Medicine publizierte kürzlich hierzu hochinteressante Erkenntnisse. Eine klinischen Studie untersuchte, wie sich eine 2-wöchige veganer Ernährung oder ketogener Diät sowohl auf die Immunität als auch auf das Darmmikrobiom auswirken.
Die Ergebnisse zeigten, dass eine ketogene Ernährung insgesamt mit einer signifikanten Hochregulierung von Signalwegen und einer Anreicherung von Zellen, die mit dem adaptiven Immunsystem in Verbindung stehen, verbunden war. Im Gegensatz dazu beeinflusst eine vegane Ernährung signifikant das angeborene Immunsystem, einschließlich einer Hochregulierung von Signalwegen, die mit der antiviralen Immunität in Verbindung stehen.
Beide Diäten wirkten sich unterschiedlich auf das Mikrobiom und den wirtsassoziierten Aminosäurestoffwechsel aus, wobei man die meisten mikrobiellen Stoffwechselwege nach der ketogenen Diät im Vergleich zum Ausgangswert und der veganen Diät stark herunterregulierte. Insgesamt zeigt diese Arbeit, dass eine 2-wöchige kontrollierte Ernährungsintervention bereits ausreicht, um deutlich messbare Auswirkungen auf die Immunität zu haben.
+
–
Zahl gesunder Darmmikroben nimmt ab
Jeder weiß, dass Ballaststoffe gesund und ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Ernährung sind. Ballaststoffe bestehen zum Großteil aus Zellulose. Sie sind in Blättern, Wurzeln, Ähren und Holz enthalten. Mit Gemüse oder Vollkornprodukten nehmen wir Ballaststoffe auf. Ballaststoffe sind gesund, da sie dabei helfen, unsere Darmflora ausgeglichen zu erhalten. Es sind vor allem Bakterien, die Zellulose verdauen können und die Zellulosebestandteile verwertbar machen. Doch unsere Essgewohnheiten in industrialisierten Gesellschaften unterscheiden sich stark von denen der frühen Menschen. Dies wirkt sich anscheinend auf unsere Darmflora aus, da laut einem neuen Bericht, der in Science veröffentlicht wurde, zelluloseabbauende Bakterien aus dem menschlichen Darmmikrobiom insbesondere in industriellen Gesellschaften verloren zu gehen scheinen.
Während der menschlichen Evolution waren Ballaststoffe immer ein Hauptbestandteil der menschlichen Ernährung. Die Wissenschaftler identifizierten wichtige neue Mitglieder des menschlichen Darmmikrobioms, zelluloseabbauende Bakterien aus der Gattung Ruminococcus. Diese Bakterien bauen Zellulose ab, indem sie große und hochspezialisierte extrazelluläre Protein-Komplexe namens Zellulosomen produzieren, die sich an die Zellulösefäden anhaften und diese auseinanderziehen, um sie enzymatisch besser in kleinere Stücke verdauen zu können. Diese kleineren Stücke werden wiederum von weiteren Bakterien abgebaut. Ruminococcus steht also an der Spitze der Ballaststoffabbau-Kaskade. Wie der Name schon sagt sind sie auch Mitglieder des Mikrobioms im Pansen von Wiederkäuern. Das heißt, es scheint, dass Menschen wichtige Bestandteile eines gesunden Darmmikrobioms von Nutztieren erworben haben, die sie früh in der menschlichen Evolution domestiziert haben.
Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Die Untersuchung ergab, dass Ruminococcus-Stämme in der Tat robuste Bestandteile des menschlichen Darmmikrobioms unter menschlichen Jägern und Sammlern sowie unter Bewohnern ländlicher Gegenden sind, doch dass sie in menschlichen Proben aus industrialisierten Gesellschaften selten oder teilweise sogar ganz fehlen. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Abkehr von einer ballaststoffreichen Ernährung eine Erklärung für den Verlust wichtiger zelluloseabbauender Mikroben in unserem Mikrobiom ist. Wie kann man also diesem evolutionären Rückgang entgegenwirken? Ganz einfach, mehr Ballaststoffe essen!
+
–
Ingwer hemmt Autoimmunprozesse
Starkoch Alfons Schuhbeck bekommt Recht, zumindest in Bezug auf seine unbestreitbaren Verdienste um die Einführung von Ingwer in die deutsche Küche.
In einer Studie, die im Herbst 2023 im Journal of Clinical Investigation erschien, wurden die Wirkung des Ingwer-Wirkstoffs 6-Gingerol auf die für Autoimmunkrankheiten charakteristische Hyperaktivität von Neutrophilen untersucht.
Das 6-Gingerol hemmte im Mausmodell die Phosphodiesterase und dämpfte die dysfunktionale Bildung extrazellulärer Neutrophilen-Fallen, die sogenannte NETose. NET-bedingte Autoimmunerkrankungen sind z. B. rheumatoide Arthritis, Lupus erythematodes oder Vaskulitiden. In Untersuchungen an gesunden Erwachsenen steigerte die Einnahme von 6-Gingerol über 7 Tage das zyklische AMP der Neutrophilen als Zeichen höherer zellulärer Fitness.
Die Autoren gehen soweit, dass die immunmodulierenden Ingwer-Inhaltsstoffe künftig eine Rolle bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen spielen könnten.
… dass sich diese Erkenntnisse für Schuhbeck strafmindernd auswirken ist unwahrscheinlich.
+
–
Bewegung und Omega-3-Fettsäuren hemmen Silent Inflammation im Alter
Anfang dieses Jahres publizierte das International Journal of Molecular Sciences eine Untersuchung über den Einfluss von Bewegung und Omega-3-Supplementen auf den Inflammationsstatus bei alten Menschen. Chronische Entzündungsprozesse stehen in klarem Zusammenhang mit der Zellalterung und Pathogenitätsprozessen im Immunsystem, welche altersbedingte Krankheiten begünstigen.
Die Autoren untersuchten, wie sich eine 8-wöchige Bewegungs- und Ernährungsintervention auf die Entzündungsreaktion bei 61 älteren Erwachsenen (Alter: 70,6 ± 4,7 Jahre; 47 % Männer) auswirkt. Alle Teilnehmer erhielten wöchentlich Vibrations- und Widerstandstraining zu Hause. Außerdem hielten die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip entweder eine proteinreiche (1,2-1,5 g/kg) oder eine proteinreiche, mit Omega-3-Fettsäuren angereicherte (2,2 g/Tag) Kontrolldiät.
Vor und nach der Behandlung bestimmte man die Entzündungsmarker im Blut sowie nach der Stimulation durch Lipopolysaccharid (LPS) im Vollblut ex vivo. Eine proteinreiche, mit Omega-3-Fettsäuren angereicherte Ernährung verringerte das zirkulierende entzündungshemmende Interleukin (IL-10) und den IL-1-Rezeptor-Antagonisten (IL-1RA). Nach Geschlecht aufgeschlüsselte Analysen ergaben, dass die pro-inflammatorischen Marker bei Männern, die sich proteinreich und mit Omega-3-Fettsäuren angereichert ernährten, ebenfalls deutlich reduziert waren. Die Genexpression von IL-1RA war nach beiden proteinangereicherten Diäten im Vergleich zu den Kontrollen signifikant reduziert.
Im Vergleich zu einer eiweißreichen Diät führte Bewegung allein zu einer geringeren LPS-induzierten Freisetzung des C-C-Motiv-Chemokin-Liganden-2 (CCL-2), die bei Männern tendenziell stärker ausgeprägt war als bei Frauen. Eine achtwöchige eiweißreiche, mit Omega-3-Fettsäuren angereicherte Ernährung in Kombination mit körperlicher Betätigung verringerte die zirkulierenden entzündungshemmenden Marker und die entzündungsfördernden Marker bei Männern. Eine eiweißreiche Ernährung schwächte die Genexpression der Entzündungsmarker in den PBMC ab. Bewegung alleine führte zu einer geringeren proinflammatorischen Reaktion auf LPS-Exposition.
Quelle:
Haß, U.; Heider, S.; Kochlik, B.; Herpich, C.; Pivovarova-Ramich, O.; Norman, K. Effects of Exercise and Omega-3-Supplemented, High-Protein Diet on Inflammatory Markers in Serum, on Gene Expression Levels in PBMC, and after Ex Vivo Whole-Blood LPS Stimulation in Old Adults. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 928.
+
–
COVID-19 Infektion erhöht Risiko für Autoimmunerkrankungen
Das Risiko, eine Autoimmunerkrankung zu erwerben, ist nach der akuten Phase einer COVID-19-Infektion erhöht und steigt mit der Schwere der Infektion. Das ergab eine große, kontrollierte Kohortenstudie mit Daten von sechs deutschen Krankenversicherungen, bei der die Häufigkeit neu diagnostizierter Autoimmunerkrankungen zwischen Personen mit und ohne dokumentierte SARS-CoV-2-Infektion verglichen wurde.
Dafür wurden Personen ausgewählt, die bis 31.12.2020 eine durch PCR bestätigte Corona Infektion durchgemacht haben. Diese 641.704 Patienten wurden mit Kontrollpatienten ohne bestätigte Corona-Infektion verglichen. Für jeden Corona-Patienten wählte man drei Kontrollen aus, die sich hinsichtlich Geschlechts, Alter und dem Vorliegen einer Autoimmunkrankheit „matchen“. Der Beobachtungszeitraum startete jeweils nach der akuten Phase der Corona-Infektion (>12 Wochen) und dauerte bis 30. Juni 2021. Es wurden Inzidenzraten (IR) von Autoimmunerkrankungen pro 1000 Personenjahren beider Gruppen geschätzt und Unterschiede verglichen (Incidence Risk Ratio [IRR]).
Die statistischen Analysen ergaben, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Neudiagnose einer Autoimmunerkrankung nach COVID-19 um 42,63 % höher war als ohne COVID-19 (IRR: 1,43). Lag bereits eine Autoimmunerkrankung vor, so war das Risiko, eine weitere zu erwerben in der COVID-19-Kohorte um 23 % höher als in der Kontrollgruppe.
Die größten Unterschiede zwischen beiden Gruppen gab es bei eher seltenen systemischen, autoimmunen Entzündungen der Blutgefäße wie Morbus Wegener (IRR: 2,51), Morbus Behçet (IRR: 2,42) und Arteriitis temporalis (IRR: 1,63). Bei häufiger vorkommenden Autoimmunerkrankungen gab es die größten Unterschiede zwischen den Gruppen bei Hashimoto-Thyreoiditis (IRR: 1,42), Morbus Basedow (IRR: 1,41), Psoriasis (IRR: 1,17) und rheumatoider Arthritis (IRR: 1,42).
Das Risiko stieg außerdem mit der Schwere der Corona-Infektion: Nach stationär behandeltem COVID-19 traten Autoimmunerkrankungen häufiger auf als bei ambulant behandelten Patienten (IRR: 1,75 vs. 1,38). Bei intensivmedizinisch Therapierten/Beatmeten war die Wahrscheinlichkeit am höchsten (IRR: 2,28).
Zu den möglichen Mechanismen, die zu einer postinfektiösen Autoimmunerkrankung führen könnten, gehören eine Persistenz des Virus oder viraler Reste, Reaktivierung latenter Viren, langanhaltende Gewebeschäden aufgrund von Mikroverklumpung oder chronischer Entzündung sowie Autoimmunität. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann die Autoimmunität nach einer Virusinfektion durch Mechanismen wie Epitopausbreitung, Bystander-Aktivierung, molekulare Mimikry und kryptische Epitope ausgelöst werden.
Dieser Preprint einer Studie bietet eine Analyse mit einem großen Datenset aus Deutschland und zeigt die Notwendigkeit auf, besonders Vaskulitis-assoziierte Symptome nach einer Infektion genauer zu beobachten, um frühzeitig eine geeignete Therapie zu starten.
Quelle:
Tesch F, Ehm F, Vivirito A, et al.: Incident autoimmune diseases in association with a SARS-CoV-2 infection: A matched cohort study. medRxiv preprint 2023; doi: 10.1101/2023.01.25.23285014
+
–
Vergleich zwischen geimpften und ungeimpften Patienten mit SARS-CoV-2 Infektion
Unter der Mitarbeit von Lab4more wurde im Journal of Immunology Research and Reports in diesem Monat ganz aktuell ein Vergleich zwischen Personen publiziert, die gegen SARS-CoV-2 geimpft und nicht geimpft waren. Obwohl die Gesamtzahl der Patienten gering ist, lassen die Ergebnisse und Tendenzen aufhorchen.
Bei insgesamt 24 Patienten im Alter von 42-66 Jahren, davon 10 ungeimpft, 5 zweifach geimpft und 9 dreifach geimpft, wurde das klinische Bild bei Infektion, die humorale und zelluläre Immunantwort sowie der Vitamin D und Vitamin C Spiegel erfasst. Zusätzlich wurden Post-COVID Symptome und typische Autoantikörper untersucht.
Die Auswertung spricht dafür, dass eine akute SARS-CoV-2-Omikron-Infektion sowohl bei ungeimpften als auch bei geimpften Patienten dieser Altersgruppe einen leichten Krankheitsverlauf verursacht. Bei geimpften Patienten zeigte die Krankheit jedoch mit jeder zusätzlichen Impfung einen tendenziell längeren Verlauf. Ungeimpfte Patienten wiesen im Vergleich zu geimpften Patienten nach einer akuten Omikron-COVID-19-Infektion keine neutralisierenden Antikörper gegen IgG-S1-Spike auf, was auf mehrfache Mutationen in der Region des Spike-Genoms in der Omikron-Variante zurückgeführt wird.
Eine akute Omikron-COVID-19-Infektion nach einer mRNA-Impfung erhöht das Risiko einer starken Immunantwort (neutralisierende Antikörper IgG-S1-Spike, Antikörper IgG-RBD, T-zelluläre Reaktion in IL2 und IFN, Autoantikörper gegen G-Protein-gekoppelte Rezeptoren ß1-ß2-M2-M3), die mit dem Risiko des Post-COVID-Syndroms korrelieren. Ein Mangel an immunmodulierenden Mikronährstoffen (Vitamin C, Vitamin D3, Selen, Zink) könnte dafür verantwortlich sein.
Quelle:
K. Erpenbach et al., SARS-CoV-2-Omicron-variant Induced COVID-19-Infection in Unvaccinated and Vaccinated Patients: Impact on Immune Response, Symptomatology, and Risk of POST-COVID Syndrome, Journal of Immunology, publ. January 25, 2023
+
–
FODMAP-Diät bei Reizdarm auf dem Prüfstand
Über eine Million Menschen sind in Deutschland vom Reizdarmsyndrom betroffen, die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Bemerkenswert ist die drastische Häufung bei jungen Erwachsenen in der Altersgruppe zwischen 20 und 30 um ca. 70 % seit 2005. Die sogenannte FODMAP-Diät (Fermentable Oligo-, Di-, Monosaccharides and Polyols Diet), bei der man Lebensmittel mit hohem Anteil an Zuckern und Polyolen vermeidet, wird als alternative, nicht-medikamentöse Therapieform bei Reizdarmpatienten eingesetzt.
Eine belgische Arbeitsgruppe der Universitätsklinik Leuven hat kürzlich eine Untersuchung im renommierten Journal GUT publiziert. An der randomisierten Studie nahmen insgesamt 459 Reizdarmpatienten teil. Nach acht Wochen verglich man die Laborparameter einer medikamentösen Therapie mit einem Spasmolytikum (Otilonium Bromid) und die einer FODMAP-Diät im klinischen Outcome miteinander. Dabei zeigte die Diät eine signifikant bessere Erfolgsquote (71 %) als die medikamentöse Therapie (61 %), dies war bereits nach 4 Wochen erkennbar.
Die Autoren resümieren, dass der Einsatz einer einfachen Diätanwendung als First-Line Ansatz zur Behandlung von Reizdarmsyndrom in der Primärversorgung betrachtet werden sollte.
Quelle:
Carbone F, Van den Houte K, Besard L DOMINO Study Collaborators, et al, Diet or medication in primary care patients with IBS: the DOMINO study – a randomised trial supported by the Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE Trials Programme) and the Rome Foundation Research Institute
+
–
Rolle des Mikrobioms bei rheumatischen Erkrankungen
Die Autoren des im April dieses Jahres in der Zeitschrift für Rheumatologie erschienenen Artikels untersuchten den Einfluss des Mikrobioms bei der Entstehung von SLE (Systemischer Lupus Erythematodes) und dem PLS (Phospholipidsyndrom). Sie kommen zu dem Schluss, dass neben den zweifelsfrei bedeutsamen genetischen Faktoren auch die Zusammensetzung des Darmmikrobioms sowie die Durchlässigkeit der Darmbarriere Risikofaktoren für den Ausbruch der Erkrankungen darstellen können.
Als ungünstige Faktoren wurden Enterococcus gallinarum und ein Stamm des Lactobacillus reuteri identifiziert, die vor allem bei Patienten mit geschädigter Schleimhautbarriere Entzündungen in Organen auslösen können. Ein zusätzlicher Pathomechanismus sind kreuzreaktive Antikörper, die initial gegen Antigene von Darmbakterien gebildet werden und dann auch ähnliche körpereigene Eiweiße angreifen. Diese Kreuzreaktivität ist für das Autoantigen Ro60 nachgewiesen, welches von Bakterien gebildet und gegen das die Autoimmunreaktion bei SLE-Patienten gefunden wird. Ruminococcus gnavus wurde zum Beispiel bei Patienten mit Lupusnephritis in verschiedenen SLE-Patientengruppen erhöht gefunden und man vermutet hier, dass dies mit einer Kreuzreaktivität gegen Doppelstrang-DNA assoziiert ist. Roseburia intestinalis, ein weit verbreiteter kommensaler Darmkeim, trägt kreuzreaktive Sequenzen zu dem APS-Autoantigen β2-Glycoprotein I (β2GPI) und kann autoreaktive Th1-Zellen und IgG-Autoantikörper gegen β2GPI induzieren.
Als therapeutische Ableitungen diskutieren die Autoren, inwieweit die Ernährung das Darmmikrobiom gezielt beeinflusst, um die Darmbarrierefunktion zu unterstützen und Pathobionten zu reduzieren. Stützend für die Darmschleimhautbarriere und damit protektiv zeigten sich Bakterien der Gruppe Clostridiales im Dickdarm, die aus faserreicher Nahrung komplexe Zucker zu kurzkettigen Fettsäuren abbauen.
Folgende Schlüsse wurden aus den Untersuchungen gezogen:
• Antibiotikagaben soweit wie möglich vermeiden
• Probiotika mit Laktobazillen bei SLE-Patienten eher nicht verwenden
• Faserreiche Ernährung bei SLE-Patienten bevorzugen
Quelle:
Sylvio Redanz, Martin A. Kriegel et al.; Die Rolle des Mikrobioms bei Lupus und Antiphospholipidsyndrom; Z Rheumatol, 2022, DOI: 10.1007/s00393-022-01184-7
+
–
Zytokinmuster bei postakuter COVID-Symptomatik
Die postakuten Folgen von COVID-19 (PASC: Post-Acute Sequelae of COVID-19) entwickeln sich zu einem globalen Problem mit unbekannten molekularen Ursachen. PASC besteht hauptsächlich aus den Symptomen Müdigkeit, Atemnot und Konzentrationsschwäche und hält oft über den durchschnittlichen Nachbeobachtungszeitraum von acht Monaten an. Eine Impfung nach der Infektion hat keinen Einfluss auf den Verlauf und trägt nicht zum Verschwinden der Symptome bei.
Die Autoren einer nun im Juni veröffentlichten Arbeit berichten von einer Untersuchung an 318 COVID-Patienten mit überwiegend leichtem Verlauf, von denen 60 % eine PASC Symptomatik auch länger als 8 Monate nach Infektion zeigten. Labordiagnostisch konnten bei diesen Patienten überraschenderweise keine klassischen Autoantikörper des rheumatischen Formenkreises nachgewiesen werden, aber signifikanter Weise erhöhte Plasmaspiegel der Zytokine IL1ß, TNF-alpha und Interleukin 6. Diese Markerkombination konnte dann an 333 weiteren Patienten in der Langzeitbeobachtung von 10 Monaten nach Infektion bestätigt werden. Alle anderen untersuchten inflammatorischen Botenstoffe wie IL8, IL17, Interferon, IL4, IL13 zeigten keine Signifikanz.
Blutprofilierung und Einzelzelldaten aus der frühen Infektion deuten auf die Induktion dieser 3 Zytokine in proinflammatorischen COVID-19-Lungenmakrophagen hin, die eine sich selbst erhaltende Rückkopplungsschleife schaffen. Die Daten sprechen dafür, dass die gleichzeitige Erhöhung der Zytokine TNF-alpha, IL1ß und IL6 im Blut einen Biomarker für die PASC Problematik darstellt.
Literatur:
• Schultheiß C, Willscher E, Paschold L, Gottschick C, Klee B, Henkes SS, Bosurgi L, Dutzmann J, Sedding D, Frese T, Girndt M, Höll JI, Gekle M, Mikolajczyk R, Binder M. The IL-1β, IL-6, and TNF cytokine triad is associated with post-acute sequelae of COVID-19. Cell Rep Med. 2022 Jun 21;3(6):100663. doi: 10.1016/j.xcrm.2022.100663. PMID: 35732153; PMCID: PMC9214726.
+
–
Verlangsamen weniger Kalorien die Immunseneszenz?
Die Verschlechterung des Immunsystems im Alter nennt man Immunseneszenz. In einer aktuellen Studie untersuchten Forscher die Wechselwirkungen zwischen kalorienreduzierter Ernährung, Mikrobiom, Stoffwechsel und dem Immunsystem. Sie zeigten, dass weniger Kalorien den Eintritt metabolischer Erkrankungen wie Insulinresistenz und Typ 2 Diabetes verzögern können. Dieser Effekt ist mit Veränderungen der Zusammensetzung und den metabolischen Funktionen des Darmmikrobioms und der daraus resultierenden immunologischen Folgen assoziiert.
Als Beispiel wurde der Stuhl einer fettleibigen Probandin vor und nach einer 8-wöchigen kalorienreduzierten Diät (800 kcal/Tag) in keimfreie Mäuse transplantiert, die selber keine Bakterien im Darm hatten. Darauffolgende Mikrobiomanalysen ergaben bei den Mäusen, die den Stuhl nach der Diät eingesetzt bekamen, eine signifikant höhere Diversität der Mikrobiomzusammensetzung. Man beobachtete eine Abnahme an Proteobakterien, die in fettleibigen Menschen überrepräsentiert sind. Außerdem hatten diese Mäuse eine geringere Fettablagerung und eine verbesserte Glukosetoleranz im Vergleich zu den Mäusen, die Stuhl von vor der Diät transplantiert bekamen. Zudem zeigte sich, dass sich die Anzahl bestimmter T- und B-Gedächtniszellen reduzierte, was darauf hinweist, dass sich die Immunseneszenz verzögert.
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die kalorienreduziert Diät zu einer Verringerung von Bakterienspezies im Darm führt, die als Adipositas-fördernd gelten und mit systemischen Entzündungen, Tumorentwicklung und metabolischen Erkrankungen assoziiert sind. Folgen davon sind verzögerte Immunoseneszenz und weniger Entzündungsreaktionen.
Quelle:
• Sbierski-Kind J et al. Effects of caloric restriction on the gut microbiome are linked with immune senescence. Microbiome. 2022 Apr 4;10(1):57. doi: 10.1186/s40168-022-01249-4.